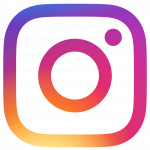Schon in den ersten Monaten der Pandemie hörte mensch aus verschiedenen Richtungen, dass Krisen existierende Ungleichheiten verschärfen – so auch die zwischen Frauen und Männern. Hier könnte nun eine Vielzahl an erschreckenden Statistiken angeführt werden, die belegen, dass verschiedenste Benachteiligungen und Gefährdungen, denen Frauen schon vor der Pandemie ausgesetzt waren, sich noch verstärkt haben. Denn Hinweise auf und Untersuchungen von diesem Phänomen sind überraschend zahlreich – es gibt sogar schon einen wikipedia-Artikel zum Thema der „gegenderten“ Effekte von Covid-19. Erst einmal ein gutes Zeichen. Ist das jedoch alles, was sich aus linker Perspektive dazu sagen lässt?
Schon in den ersten Monaten der Pandemie hörte mensch aus verschiedenen Richtungen, dass Krisen existierende Ungleichheiten verschärfen – so auch die zwischen Frauen und Männern. Hier könnte nun eine Vielzahl an erschreckenden Statistiken angeführt werden, die belegen, dass verschiedenste Benachteiligungen und Gefährdungen, denen Frauen schon vor der Pandemie ausgesetzt waren, sich noch verstärkt haben. Denn Hinweise auf und Untersuchungen von diesem Phänomen sind überraschend zahlreich – es gibt sogar schon einen wikipedia-Artikel zum Thema der „gegenderten“ Effekte von Covid-19. Erst einmal ein gutes Zeichen. Ist das jedoch alles, was sich aus linker Perspektive dazu sagen lässt?
Unter anderem wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass Fälle häuslicher und sexueller Gewalt global ansteigen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen António Guterres reagierte darauf mit der Forderung nach einem „Waffenstillstand“ in der Gewalt gegen Frauen (so dass mensch sich fragen kann, ob das alles ist, was mensch sich noch wünschen darf). Das Kinderhilfswerk Plan schreibt, zuhause könnten Frauen „sich (und andere) zwar effektiv vor einer Ansteckung schützen, nicht aber vor gewalttätigen Übergriffen innerhalb der Familie“. Krisenzeiten seien besonders für Frauen und Mädchen „gefährlich“, schreibt auch UN Women, wegen fehlenden Schutzes vor Gewalt.
Es ist äußerst wichtig, auf solche Fakten hinzuweisen und kurzfristige Lösungen zu finden, wie beispielsweise die Bereitstellung einer höheren Anzahl an Notrufnummern und Schlafplätzen für vor Gewalt fliehenden Frauen und Mädchen. Und dass auf diese Zahlen schon zu einem frühen Zeitpunkt der Pandemie aufmerksam gemacht wurde, spricht für zumindest gewisse Erfolge des Versuchs, Gewalt gegen Frauen zu einer bekannten Problematik zu machen. Für eine linke Perspektive reicht es jedoch bei Weitem nicht aus, lediglich darauf hinzuweisen, die Krise verschlimmere schon dagewesene Ungleichheiten. Phänomene wie häusliche Gewalt erscheinen so in der Form einer Naturgewalt, vor der sich schlicht in Schutz gebracht werden müsse. Aber die „Schwachen“ der Gesellschaft haben nicht einfach Pech gehabt, dass jetzt auch noch eine globale Gesundheitskrise ihre Benachteiligung schwerer wiegen lässt. Häusliche Gewalt ist kein Virus, der im Gegensatz zu Corona zuhause eine Gefahr darstellt. Es sind strukturelle Gründe, die bestimmen, auf welche die Probleme der Pandemie abgewälzt werden.
Ein struktureller Grund, der für einen feministischen Blick auf die Pandemie im Fokus stehen sollte, ist die Trennung zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit. Seit Beginn der Pandemie sind Maßnahmen gegen das Virus vor allem auf das Privatleben gerichtet, in Form von Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren. Auch mit den Anfang Januar eingeführten Vorschriften wird vor allem das Privatleben weiter eingeschränkt. Anstatt von einer automatischen Verschärfung bestehender Ungleichheiten auszugehen, muss gefragt werden, auf welcher Basis diese Strategie zur Bekämpfung der Pandemie legitim erscheint, und ob ein ganz anderer Umgang möglich wäre, wenn der Schutz von unterdrückten und benachteiligten Gruppen, nicht wirtschaftlicher Erfolg im Fokus der Politik stünde. Die den Maßnahmen zugrundeliegende Logik ist eine von kapitalistischen und patriarchalen Werten getragene Trennung von Privatsphäre und Öffentlichkeit, die sich in der Pandemie anbietet, um Verpflichtungen und Einschränkungen auf das Individuum abzuwälzen, anstatt sich um eine solidarische Lösung zu kümmern. Dazu gehört nicht nur die Inkaufnahme der Gefährdung von Frauen und Kindern durch häusliche und sexuelle Gewalt, sondern auch die Belastung durch zusätzlich anfallende Sorgearbeit, wenn Schulen und Kitas geschlossen bleiben.
Die Trennung von Öffentlichkeit und Privatsphäre wird von feministischen Theoretikerinnen und Aktivistinnen schon lange einer tiefgreifenden Kritik unterzogen. Als beispielsweise Anfang der 1970er Jahre Feministinnen verschiedener Länder einen „Lohn für Hausarbeit“ forderten, wollten sie nicht lediglich finanzielle Unterstützung für Sorgearbeit leistende Frauen erreichen, sondern diese naturalisierte und individualisierte Form von Arbeit zu einer politischen Angelegenheit machen. Diese Thematik stellte einen bedeutenden Schnittpunkt von Kapitalismuskritik und Feminismus dar, weil der Standpunkt der Hausfrau sowohl die Unterdrückung von Frauen im Patriarchat als auch ihre Rolle in der kapitalistischen Organisation der Arbeit deutlich machte. Nur durch die Verdrängung in die Privatsphäre konnte dies als unpolitisches und naturalisiertes Phänomen erscheinen.
„The personal is political“ schrieb die amerikanische Feministin Carol Hanisch damals und brachte damit eine zentrale These der feministischen Bewegung auf den Punkt: Was natürlich, privat, persönlich scheint, muss zum Fokus von Kritik werden, weil gerade hier verschiedene Formen von Unterdrückung verschleiert werden. Nach den seitdem vergangenen Jahrzehnten, geprägt von Neoliberalismus und Backlash gegen vor allem radikalere Formen des Feminismus, stehen wir heute vor denselben Problemen. Die Aspekte des Privatlebens, die Feministinnen damals zu einem zentralen Bestandteil ihres Aktivismus machten – nicht nur unbezahlte Hausarbeit, sondern auch das Ideal einer heterosexuellen Ehe und eines Familienlebens – tragen heute dazu bei, dass Frauen in der Pandemie häuslicher Gewalt ausgesetzt sind und ein erhöhtes Maß an Sorgearbeit leisten müssen. Denn die Logik der Maßnahmen gegen das Virus wird gestützt durch die noch immer natürlich erscheinende Trennung von Privatleben und Öffentlichkeit, persönlichen und sozialen Problemen, individuellen Angelegenheiten und strukturellen Phänomenen.
Dieser Blick in die Geschichte der feministischen Bewegung zeigt uns, dass es kein Automatismus ist, wenn die Lage von Frauen und Mädchen sich in der Pandemie verschlechtert. Die Sorgearbeit, die Frauen leisten, ist keine Selbstverständlichkeit, und häusliche und sexuelle Gewalt ist kein depersonifiziertes Virus, das in Krisenzeiten besonders gefährlich wird. Es ist patriarchale Unterdrückung, die Frauen und Mädchen bedroht, es sind Männer, die diese Gewalt ausüben, und kapitalistische Zustände, die auf der Ausbeutung unbezahlter Hausarbeit aufgebaut sind. Was wir also brauchen, sind nicht noch mehr Zahlen, die die kritische Lage von Frauen bezeugen. Wir brauchen eine Analyse ihrer strukturellen Unterdrückung, die zeigt, warum sich diese unter Pandemiebedingungen verschärft, und eine feministische Bewegung, in der wir gemeinsam auf die Überwindung des Patriarchats in all seinen Formen hinarbeiten. So kann feministische Theorie und Praxis ein bedeutender Teil davon werden, andere Wege des Umgangs mit dem Coronavirus zu finden.
Antifaschistische Initiative Heidelberg/iL im Januar 2021